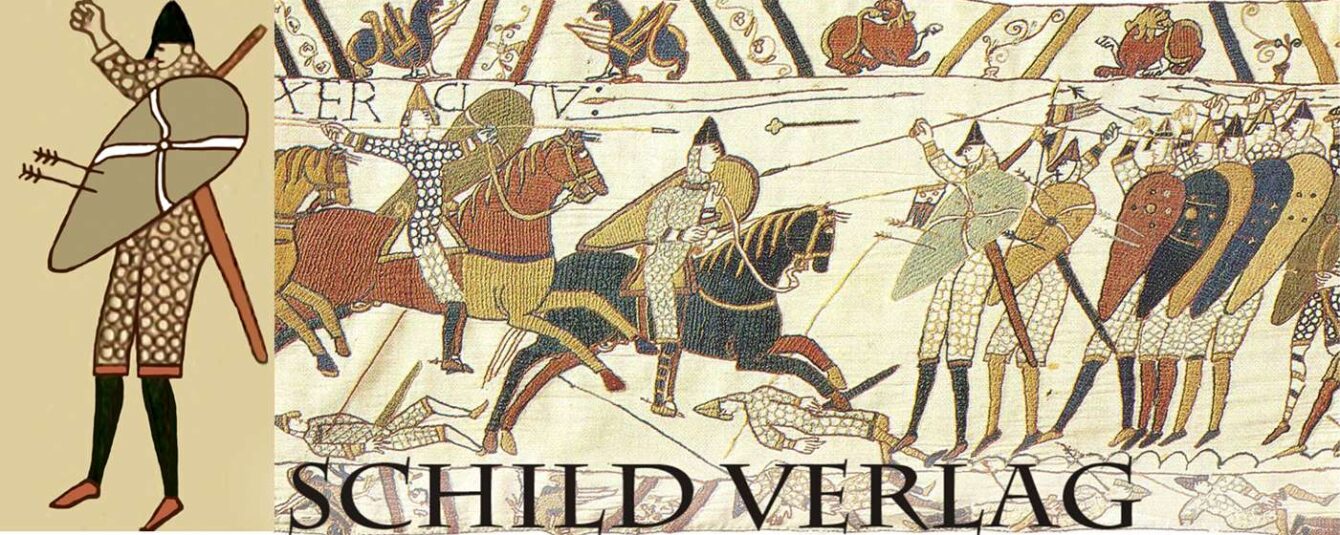Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt
Jetzt hat Kanada ein Problem. Es schwärt schon lange und wird mit Geld und Sozialprogrammen erstickt. Der „First Nations Child and Family Services Funds“ tut sein bestes, aber die wenigen Prozent der Bevölkerung ausmachenden Indigenen sind dennoch benachteiligt. Man demonstriert heute Verantwortung und Bedauern für das, was die massive Einwanderung aus Europa mit den „First Nations“ gemacht hat, hofiert Musiker und Künstler mit indigenen Wurzeln. Ganz langsam bildet sich ein neues Selbstbewusstsein. Der grausige Fund der Kinderleichen illustriert, was „Umerziehung“ einer eroberten und überfremdeten Ethnie antut.
Sie haben die höchste Rate an Selbstmorden, auch unter Kindern. Alkoholismus und Gewalt in den Familien ist weiter verbreitet, als bei den weißen Einwanderern, die alte Kultur weitgehend zerstört. Viele kennen ihre alte Sprache nicht mehr. Eine Berufsausbildung schaffen nicht sehr viele. Das Leben in den Reservaten ist staatlich finanziert, was auch bei vielen das Äquivalent von „hartzen“ fördert.
Ich möchte hier anmerken, dass ich da tatsächlich Einblicke habe. Ich war oft da, ich kennen viele Indigene näher, habe einen sehr lieben Freund aus dem Adlerclan des Stammes der Ojibwe, Jay Bell Redbird (sein indianischer Name übersetzt „Medicin Wind“) verloren. Ein begnadeter Künstler, ein großer Bär und Spaßvogel. Ich habe von ihnen viel gehört von dem, was in den Artikeln „Residential Schools“ genannt wird. Ein anderer First Nations-Künstler, David Brooks, war als Kind noch in einer dieser Kinder-Guantanamos. Manchmal redete er davon. Es hat ihn für sein Leben geprägt und seelisch gebrandmarkt.
Entstanden sind diese Residential Schools aus den französischen Missionarsschulen, hier vor allen denen der Jesuiten. Während die europäischen Einwanderer mit ihrer bäuerlichen Struktur und Städtebau mit ihrer Beanspruchung von Land und Ressourcen die eigentliche Einwohner Kanadas systematisch verdrängten, waren die halbnomadischen Ureinwohner auf große, freie Landflächen und die Natur angewiesen. Man hatte anfangs vielleicht wirklich in „guter Absicht“ versucht, den „Halbwilden“ Bildung und Erziehung angedeihen zu lassen. Doch die Lehrer stellten bald frustriert fest, dass die Schüler meist abwesend waren, besonders während der Jagdsaison. So war Bildung nicht vermittelbar, hieß es.
Da aber die Prairiebüffelherden, eine Hauptnahrungsquelle der First Nations, ausgerottet waren, hungerten die Indianer, was deren Selbstverständnis und Traditionen und Religion zuwider lief. Es machte sie aber auch wehrlos. So griff man zu Zwang und machte den Schulbesuch für alle indigenen Kinder verpflichtend und verhinderte auch sehr leicht den Kontakt zu Stamm und Sippe, weil die Schulen fast immer außerhalb der Reservate lagen.
Neben der Peitsche bot man auch Zuckerbrot: 1857 wurde der „Gradual Civilization Act“ (Gesetz zur schrittweisen Zivilisierung) verabschiedet. Danach sollte jeder Eingeborene, nachdem er seine Schulbildungen abgeschlossen hatte, 50 Acre Land erhalten (womit er auch alle seine Vertragsrechte aus den Verträgen mit der kanadischen, weißen Regierung verlor). Man beabsichtigte, auf diese Weise die nomadischen First Nations zu sesshaften Bauern zu machen.
Es leben heute noch einige, die in diesen ach-so-christlichen Kindergefängnissen waren. In ganz Kanada gab es etwa 140 solcher Einrichtungen. Während der Zeit zwischen 1890 bis in die späten 1970er Jahre, 80 Jahre lang, wurden die Kinder systematisch zwangsweise aus den Familien geholt und umerzogen. Zu allem Überfluss auch noch unter kirchlicher Leitung. Ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Mythologie und Religion, ihre Bräuche, ihre Namen, ihre Familienbande sollten zerstört werden, sie durften ihre Familien nicht sehen – und das ist auch weitestgehend gelungen. Dabei ging es nicht sanft und überzeugend zu, sondern mit harten Strafen, seelischen und körperlichen Misshandlungen.
Wurde ein indigenes Kind dabei erwischt, dass es seine Muttersprache benutzte, bekam es Schläge und sein Mund wurde mit Seife ausgewaschen, bis das Kind sich erbrach. Sie mussten Englisch oder Französisch sprechen. Schläge und Prügel waren an der Tagesordnung. Sogar ihre harmlosen, kindlichen alten Stöckchen- und Hüpf-Spiele waren streng verboten und mit brutalen Strafen belegt. Immer wieder flüchteten Kinder aus diesen Umerziehungs- und Straflagern, die als Internat bezeichnet wurden. Andere Kinder starben an den Misshandlung, Vernachlässigung, Tuberkulose, Unterernährung und dem notorischen Missbrauch oder brachten sich selbst um. Die Sterblichkeit unter den Kindern lag fünf Jahre nach der Einschulung bei 35-60 Prozent.

Innerhalb einer Generation starben auf diese Weise viele der zahlreichen indigenen Stammessprachen aus. Die Kinder konnten sich, wenn sie aus der Schule lebend herauskamen, kaum noch mit ihrer Familie verständigen, waren nicht mehr integrierbar und restlos gegen ihre Herkunft indoktriniert. Das, was sie in den Schulen gelernt hatten, konnten sie aber in der traditionellen Umgebung nicht brauchen. Die Jugendlichen aus den Schulen waren für ihre Familien verloren, für die weißen Kanadier aber dennoch „Halbwilde“ und nur wenige der Schüler konnten in der Welt der Weißen Fuß fassen und einen Beruf erlernen. In ihren Familien waren sie auch nicht mehr daheim, ihre Selbstachtung war ihnen herausgeprügelt worden und so verfielen sehr viele dem Alkohol, wurden lethargisch oder gewalttätig, gaben sich auf oder wurden kriminell. Was dann sie dann in den Augen der Weißen noch unnützer und „unzivilisierter“ erscheinen ließ.
Das ganze Grauen hinter den Schulmauern fand unter der Überschrift „Allgemeiner Zivilisierungsauftrag“ statt. Heute wird diese Arroganz und Grausamkeit in Kanada als „cultural triumphalism“ (Kultureller Triumphalismus) bezeichnet. Erst in den 1990er Jahren kam das ganze Elend und Ausmaß der Misshandlungen und Missbräuche in den Residential Schools ans Tageslicht. Man fand heraus, dass die Kinder dort sogar ohne Wissen und Einwilligung der Eltern zu medizinischen Versuchen missbraucht wurden. Jetzt wurde erst richtig deutlich, was diese Residential Schools eigentlich waren und welcher furchtbare Schaden angerichtet worden war: Unglaubliche Todeszahlen, die Verachtung, Zerstörung und Verunglimpfung der indigenen Kultur, brutaler Rassismus, Arroganz, und Dünkel aus Unverständnis, Zerstörung der Selbstachtung der Ureinwohner, nicht wieder gut zu machende Traumata, die über Generationen nachwirken.
Ab 1874 wurden in Kanada rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern (Indianer, Mestizen, Inuit) von ihren Familien getrennt, aus ihrer Kultur gerissen und ihre Persönlichkeit zerstört.
Diese Wunden verheilen nicht.
Nun wurden 215 Kinderleichen auf dem Gebiet einer solchen kanadischen Residential School ausgegraben. Viele ungeklärte Kinderschicksale können nun aufgeklärt werden, viele Familien werden nun die traurige Sicherheit haben, dass ihr vermisstes Kind einfach verscharrt worden ist und man es nicht einmal für nötig befand, die Familien zu unterrichten. Die jüngsten Kinder waren zum Zeitpunkt ihres Todes drei Jahre alt.
Das „Internat“ lag in Kamloops, einer Stadt in der kanadischen Provinz British Columbia, an der Pazifikküste. In diesem Bundesstaat ist es so, wie man sich in Europa Kanada vorstellt. Riesige Wälder, Gebirge, Grizzlys und Lachs in den Flüssen, das Stammesgebiet der Secwepemc-Indianer, das tief in das heutige Gebiet der USA hineinreicht.
Das ehemalige Internat, das von der katholischen Kirche im Auftrag der kanadischen Regierung betrieben wurde, war eine von 139 solcher Einrichtungen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Kanada errichtet wurden. Es wurde 1890 eröffnet und hatte in den 50er-Jahren bis zu 500 Schüler. Erst 1969 wurde das Internat geschlossen.
In den Stammgemeinschaften der First Nations in Kamloops gab es schon immer das Wissen, dass es dort um das düstere Gemäuer ein Massengrab geben musste. So viele Kinder konnten nicht spurlos verschwinden und geflohene Kinder hatten Dinge gesehen und gehört. Die damalige Schulleitung hat den Tod dieser Kinder noch nicht einmal in irgendwelchen Akten dokumentiert. Die Nachfragen der Stammesmitglieder wurden ignoriert.
Wie und warum diese Kinder gestorben sind, ist noch nicht geklärt. Die meisten von ihnen haben noch lebende Geschwister. Die Indigene Gemeinde will nun mit Gerichtsmedizinern und mit DNA-Proben herausfinden, welche Kinderleiche in welche Familie gehört und woran das Kind jeweils verstorben ist. Ab Juni sollen vorläufige Ergebnisse in einem ersten Untersuchungsbericht veröffentlicht werden.
Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, heute für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten verantwortlich. Ottawa entschuldigte sich im Jahr 2008 offiziell bei den Überlebenden der Internate. Sie seien Opfer eines „kulturellen Genozids“, stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.
In der östlichsten Provinz Kanadas, Nova Scotia (Neuschottland), gibt es das größte indianische Kulturzentrum Ostkanadas der Initiative Friends United, deren Gründer und Unterstützer Rolf Bouman die Kultur und fördert und auch indianische Schulen in den Stammessprachen unterstützt. Hier einmal ein Einblick in das Kulturzentrum auf Cape Breton, Nova Scotia.
Dieser Beitrag wurde überarbeitet und erschien zuerst auf der Webseite „DieUnbestechlichen.com„